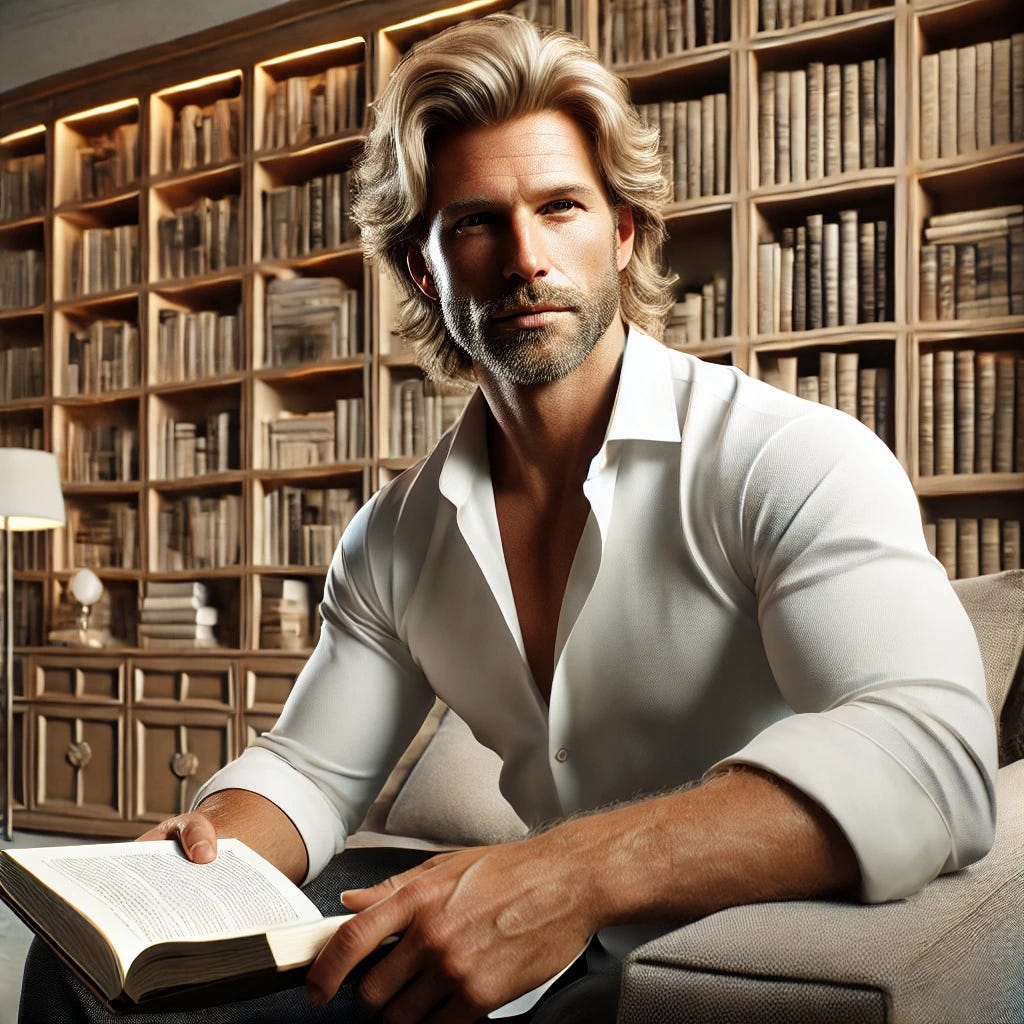Im April konnte ich vier Bücher beenden, drei hatte ich auch im April begonnen, eines war noch aus dem März übrig und wurde nun abgeschlossen.
Bei einem Buch handelte es sich um einen Reread, alles andere waren Erstbegegnungen. Ein Sachbuch traf auf einen Roman, eine Essaysammlung und einen Band, der Essays und fiktionale Kurztexte vereinte (das war das erneut gelesene Buch).

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Bücher:
Marx, Wagner, Nietzsche: Welt im Umbruch
Herfried Münkler, Marx, Wagner, Nietzsche: Welt im Umbruch, 2021, Tb. 2023, Rowohlt, 720 Seiten.
Hier habe ich im März 364 Seiten gelesen.
Eindruck: Zu diesem Buch habe ich ja bereits im letzten Leserückblick etwas gesagt. Ich bleibe dabei:
Das vorliegende Buch stellt einen ambitionierten Versuch dar, durch einen interdisziplinären Ansatz am Beispiel der drei Autoren Marx, Wagner und Nietzsche einen Rahmen für den tiefgreifenden Wandel der Weltordnung im Laufe des 19. Jahrhunderts zu entwerfen. Er beschäftigt sich dabei nicht nur mit einzelnen historischen Umbrüchen, sondern arbeitet auch den ideengeschichtlichen Zusammenhang – also die Art und Weise, wie kulturelle und politische Kritik miteinander verflochten sind – heraus.
Das liest sich alles flüssig und nachvollziehbar, bietet eine Fülle von interessanten Einsichten und Hinweisen und regt zum Mehr- und Weiterlesen an.
Die schöne Gewohnheit zu leben
Martin Mosebach, Die schöne Gewohnheit zu leben. Eine italienische Reise, 1997 (2010), Berlin Verlag, 189 Seiten.
Ein Buch nach fünfzehn Jahren erneut zur Hand zu nehmen, ist sicher nicht ohne Risiko - wird es mir wieder gefallen?
Mosebach greift mit dieser Sammlung von Texten die deutsche Italiensehnsucht auf und verleiht ihr eine gegenwärtige Gestalt, indem er kühn Themen und Textgenres mischt. Den besonderen Reiz macht dabei aus, daß das Land und seine Menschen nicht lediglich aus einer schwärmerischen Außenperspektive gezeichnet wird, vielmehr eine echte Vertrautheit zu erkennen ist.
Jens Jessen hat den Autor 2007 in der ZEIT wie folgt charakterisiert:
Das Wesen des Reaktionärs, sagt Gómez Dávila, sei Sympathie für die verlorene Sache. Das kann man eins zu eins auf Mosebach übertragen. Denn Mosebach kann natürlich kein Konservativer sein; denn er sieht, so weit sein Auge blickt, in dieser Gesellschaft nichts, was sich zu konservieren lohnte. Er sieht aber überall und überscharf das Verlorene. Da das Verlorene aber nun einmal verloren ist und Mosebach kein Putschist ist, der das Verlorene zurückbomben möchte, weil ebendieses Bomben und Zurückbomben für ihn ein Kennzeichen der Moderne ist, bleibt ihm nur die literarische Sympathie für den Verlust.
Diese Grundhaltung wird auch in den vorliegenden Texten spürbar.
Der Ultramontane
Martin Mosebach, Der Ultramontane. Alle Wege führen nach Rom, 2022, Rowohlt, 171 Seiten.
Die sechzehn Essays sind zwischen 1995 und 2012 erschienen und zumeist in Zeitungen oder Zeitschriften veröffentlicht worden. Der titelgebende Essay wurde in der Sammlung erstmals veröffentlicht.
Mosebach, der ja als katholischer Intellektueller gilt - und bei vielen verschrien ist - beschäftigt sich mit Rom zwar auch als Stadt, aber in erster Linie steht die Stadt in den vorliegenden Texten für die Weltkirche. Sie ist damit Kontrastfolie für den deutschen Katholizismus, der Mosebach bestenfalls noch als lau gilt.
Für einen Protestanten wie mich ging es an manchen Stellen etwas penetrant um Lourdes, generell jedoch waren die glänzend geschriebenen Texte interessant und - um das obige Zitat von Jens Jessen aufzugreifen - ein Lob des Verlorenen, aber markieren auch selbst eine Leerstelle, weil es nach meiner Auffassung an vergleichbaren deutschsprachigen Autoren fehlt.
Mein Name ist Marcello
Evelina Jecker Lambreva, Mein Name ist Marcello, 2024, Braumüller, 276 Seiten.
Eine bekannte Autorin von Kriminalromanen sieht sich in einer Lesung mit dem Vorwurf eines Zuhörers konfrontiert, in ihrem neuesten Buch seine Lebensgeschichte gestohlen zu haben.
Von hier aus tauchen wir in die Vergangenheit der Autorin, aber auch in die des unbekannten Mannes ein und erleben, wie sich ihre Pfade kreuzen - mit überraschenden Folgen!
Die Geschichte ist, wenngleich insgesamt doch allzu überdreht, packend und so erzählt, daß ich wissen wollte, wie es weitergeht. Stilistisch war ich jedoch immer wieder enttäuscht, der Roman kam mir gelegentlich wie eine Ziehharmonika vor, deren Balg zusammengeschoben und wieder auseinandergezogen wird.
Vor ferne weckte das Thema Erinnerungen an das Buch Nach einer wahren Geschichte von Delphine de Vigan.
My newsletter in English:
Andere Essays von mir:
1813 - 1913 - 2013
Dieser Artikel wirft einige Schlaglichter auf zweihundert Jahre europäischer Geschichte und erscheint hier in aktualisierter und erweiterter Form (ursprünglich veröffentlicht am 27. Januar 2014 auf www.notizhefte.com).
Der Treffpunkt deutschsprachiger Substacker: