Revolution, Straßenkämpfe, Gewalt – das gab es 1918/1919 beileibe nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Dieser Beitrag erläutert, warum die Geschehnisse in München besonders waren.
Warum München?
Der Fokus von Betrachtungen über die deutsche Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert liegt oft auf Berlin, das dann meist auch noch in Konkurrenz zu anderen europäischen Metropolen wie Wien, London oder Paris gesehen wird. Gerne übersehen werden die anderen deutschen Großstädte wie Hamburg, Köln, Dresden oder eben München.
Das ist schade. Denn München leuchtete, wie es Thomas Mann es eingangs der 1902 erschienenen Erzählung Gladius Dei so treffend formulierte.
(Foto: Von Reinald Kirchner - https://www.flickr.com/photos/rkirchne/3538957268/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94214718)
München war bis 1918 eine der bedeutenderen unter den zahlreichen Residenzstädten in Deutschland, Hauptstadt eines Flächenstaates in Europas (Kurpfalz-Bayern war am Ende des 18. Jahrhunderts das drittgrößte Gebiet im Alten Reich; das heutige Bayern ist ungefähr so groß wie Irland) und seit 1255 – mit Unterbrechungen – Sitz einer seit 1180 herrschenden herzoglichen und später kurfürstlichen Dynastie, die in der napoleonischen Ära die Königswürde erlangt hatte (1806) und auch zwei Kaiser des Heiligen Römischen Reiches stellte.
München hatte sich um 1900 zu einem Zentrum der künstlerischen Avantgarde des Deutschen Reichs entwickelt. Die sprichwörtliche Liberalitas Bavarica1 ermöglichte, was in der preußischen Residenz und gleichzeitigen Reichshauptstadt Berlin zu dieser Zeit nicht in gleichem Ausmaß vorstellbar war: Experimente und Innovationen. Während Wilhelm II. den technischen Fortschritt begrüßte und förderte, hielt er an einem traditionellen, akademischen Kunstbegriff fest und mißbilligte die von ihm so genannte Rinnsteinkunst.
München hingegen bot vielen bildenden Künstlern (Der Blaue Reiter) und Schriftstellern – darunter auch vermehrt Frauen – den Raum, um ihre neuen Ideen und Vorstellungen ausprobieren zu können. Prinzregent Luitpold – der selbst einen konservativen Kunstgeschmack pflegte – unterstützte die zeitgenössische Kunst durch Ankäufe. Ein mäzenatisches Königshaus und das südeuropäisch-liberal-katholische Klima sowie eine Tradition von „Freizeitvergnügen und Amüsierbetriebe[n]“ (Tworek, S. 20) wirken magnetisch auf Künstler, Schriftsteller und alle, die dies werden wollen. Rasch wird Schwabing zum bevorzugten Viertel der Ankömmlinge aus Europa, dem ganzen Reich und aus allen Teilen Bayerns.
Spätestens am 1. August 1914 endet diese Zeit. Der Krieg, der nicht aufhören will, und die unruhige Zeit danach verändern das ganze Land, aber besonders auch München. Viele Männer ziehen in den Krieg, kommen um oder kehren versehrt zurück. Andere berauschen sich am Schreibtisch und im Kaffeehaus an der Zeitenwende, die der Krieg nach der mehr als vierzigjährigen Friedensphase endlich bringen soll. Doch auch gegenteilige Positionen werden artikuliert – seltener zwar, aber immerhin.
Wie sollte es weitergehen, wenn einmal Frieden herrschen würde?
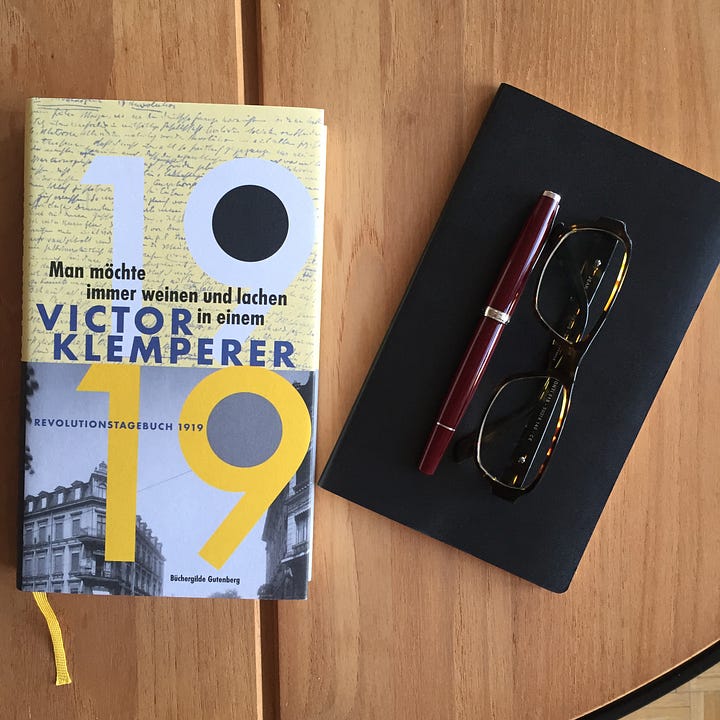
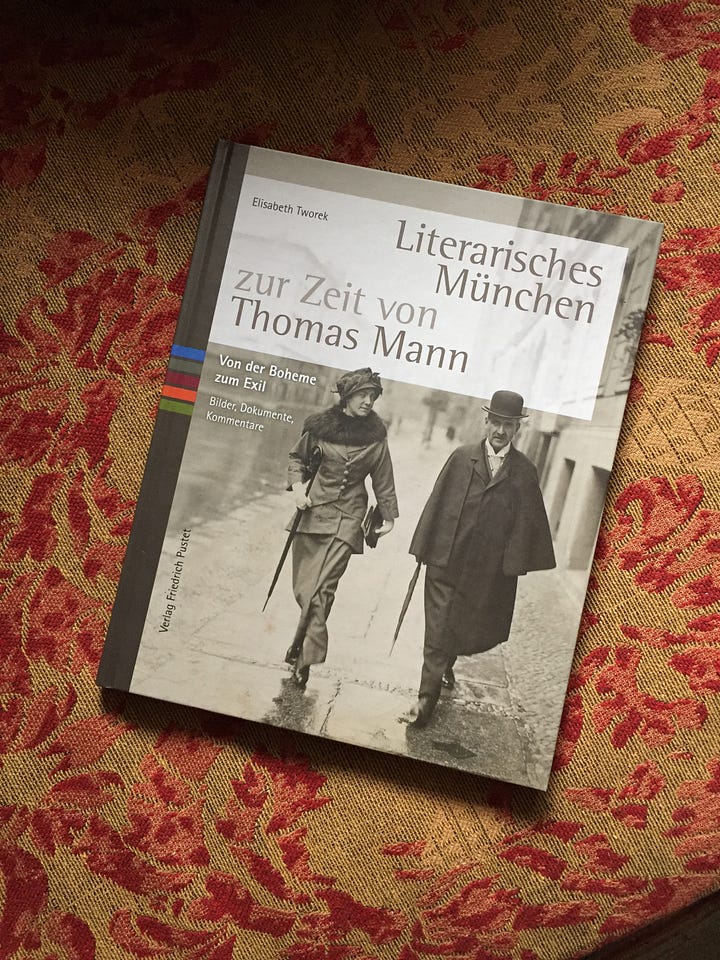
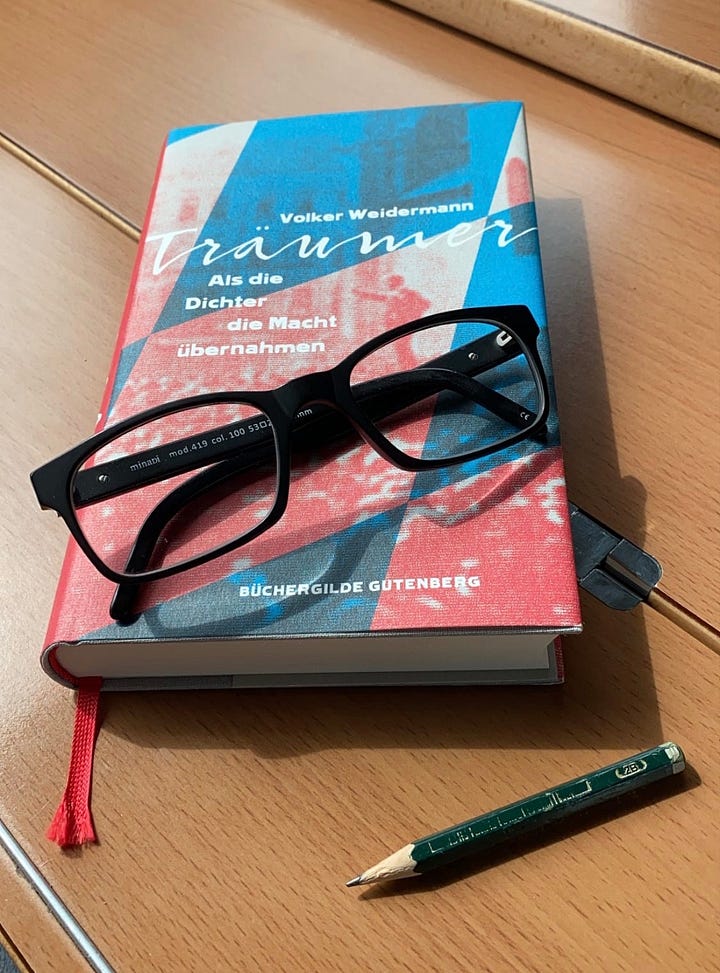
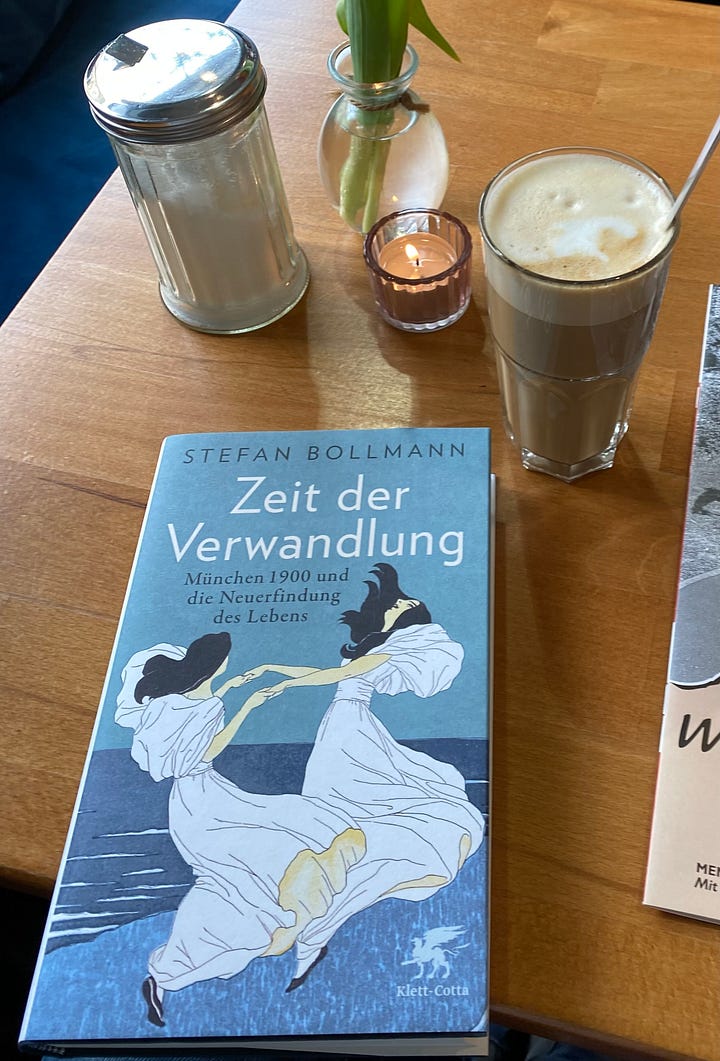
Die Revolution im literarischen Rückblick
Welches Potential bot München für einen Neustart nach dem Krieg? Wie überall im Land hatte man, getäuscht durch die Pressezensur, an den Sieg des Reichs geglaubt und war perplex über die tatsächliche Lage. Soldaten- und Arbeiterräte, die sich nach sowjetrussischem Vorbild rasch von Kiel aus über das ganze Land verbreiteten, erreichten naturgemäß auch München, wo sie auf eine hochkonzentrierte Mischung aus Schwärmern, Intellektuellen und Ideologen traf.
Hier setzt Volker Weidemanns Buch ein, am 7. November 1918, mit einer turbulenten Schilderung der fast beiläufigen Revolution, des gewaltlosen Sturzes der Wittelsbacher. Im Zentrum des Geschehens stehen Männer wie Kurt Eisner, der Ministerpräsident wird, und Oskar Maria Graf oder Rainer Maria Rilke, die beobachten, kommentieren, hoffen und verzweifeln.
Thomas Mann, der sich in erster Linie um sein Wohlergehen und das seiner wohlhabenden Familie sorgt, wird als Statist und um Positionen ringender – oder Posen ausprobierender – Chronist der Ereignisse gezeichnet. Ernst Toller, der in die Geschichte als Gedichte schreibender Jüngling hineingleitet, wird im hingegen weiteren Verlauf immer wichtiger und – seiner historischen Bedeutung2 entsprechend – den Schlußakkord des Textes setzen.
Adolf Hitler ist in diesen Monaten zunächst noch ein unbekannter und unbedeutender Heimkehrer, ein Mann der seinen Platz und seine Aufgabe noch finden muß. Doch dies wird schneller gelingen, als allen Beteiligten lieb sein kann. Seine Erwähnungen in Weidermanns Buch belegen dies eindrücklich. Überhaupt nimmt die Darstellung von Politik in Idee, Programm und Ereignis immer mehr zu. Die Dichter werden zu entrückten Phantasten, zu ängstlichen Beobachtern, zu Enttäuschten. Das Heft des Handelns entgleitet ihnen zusehends.
Nichts ist festgefügt, alles bleibt im Fluß. Die Revolution ist keine Sache Münchens oder Bayerns allein. Größere Zusammenhänge, weiterreichende Interessen, neue Meistererzählungen werden wirkmächtig: Oswald Spengler veröffentlicht seinen Untergang des Abendlandes, ein Buch, von dem in den 1920er Jahren mehr als 600.000 Exemplare verkauft werden. Adolf Hitler liest es 1924 während seiner Haft nach dem gescheiterten Putsch, ist aber angeblich nicht begeistert, weil er den Untergangsfatalismus ablehnt und mit seiner Bewegung die europäischen Völker wieder aufrichten will.
Ängste und Haß bauen sich auf, jeder spürt, es wird bald Vergeltung geübt werden. Die Revolution bleibt Episode. Das in München und anderenorts vorhandene Mobilisierungspotenzial der Revolutionszeit kann nicht genutzt werden.
Die Eindrücke des Zeitgenossen
Diesen Eindruck bestätigt auch das Revolutionstagebuch von Victor Klemperer. Er schaut eher belustigt auf die revolutionären Umtriebe – auch Weidermann spricht von „Karnevalstage[n] der Demokratie“ (S. 68) – und registriert gleichzeitig sorgenvoll sich mehrende Anzeichen von Antisemitismus, der in der verhängnisvollen Figur des „jüdischen Bolschewisten“ seinen Ausdruck findet.
Klemperer – Kriegsheimkehrer, habilitierter Romanist, konvertierter Jude – hofft in München auf Entlassung aus der Armee, eine Anstellung als Privatdozent an der Universität, eine Wohnung und einen Studienplatz für seine Frau als Organistin. Eher zufällig wird er zusätzlich Korrespondent3 für die Leipziger Neuesten Nachrichten und schickt Berichte über die Geschehnisse in München nach Leipzig, wo aufgrund der Wirren der Revolutionszeit aber nur ein Teil der Artikel ankommt und gedruckt wird.
Die im Nachlaß entdeckten Texte werden in der hier zugrundegelegten Ausgabe mit späteren Aufzeichnungen (1942) über Klemperers frühe Münchener Zeit konfrontiert: Eine interessante Kombination der zeitgenössischen mit der zurückschauenden, sich aber erkennbar auf die seinerzeitigen Notizen stützenden Perspektive. Dabei kommt es allerdings zu einigen Wiederholungen beschreibender Passagen, denen in der späteren Fassung nicht zwingend eine Analyse beigegeben wird. In der Regel erkennt man aber eine Straffung und Ergänzung, wodurch sich ein umfassenderes Bild ergibt.
Die Lebendigkeit und Farbigkeit der Schilderungen, der leicht amüsierte Blick auf eine für Klemperer in mehrfacher Hinsicht fremde Welt und eine Vielzahl authentischer Eindrücke (etwa S. 79ff.) machen das Buch zu einer sehr lohnenden Lektüre. Ein Beispiel:
Erich Mühsam, der Edelanarchist, dessen Stern im Berliner Café des Westens aufging und der in München lange sanften literarischen Glanz ausstrahlte (trotz aller edelanarchistischen Lichter), ehe er sich mit wirklicher blutiger politischer Röte erfüllte, Mühsam, der von Natur immer ein liebevolles, hilfreiches, unkriegerisches Geschöpf war und über dessen revolutionäres Heldentum man auch heute gern lächeln würde, wenn es nicht doch auch verwirrend und gefährdend wirkte, ist ja als Berliner W-Pflanze bekannt geworden. D.h., er ist erst dorthin verpflanzt worden. Aufgewachsen ist er als Sohn eines Lübecker Apothekers in der damals noch so stillen Hansestadt. (S. 11f.)
Der Umbruch erhält auf diese Weise die Unschuld des Neuen, bekommt aus der hinzugefügten Perspektive der NS-Zeit aber auch die Tiefendimension seiner langfristigen Wirkungen. Romain Rolland4 schreibt vergleichsweise erschöpfter, ausgelaugter – etwa über den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sowie über ihre Beisetzung. Klemperer schaut aus der Nähe auf die Ereignisse, auch wenn das Tempo der Revolution münchnerisch mäßig erscheint, sind die Veränderungen gleichwohl kolossal.
Ausblick
Nachdem die Münchener Räterepublik blutig niedergeschlagen worden war, entwickelte sich im folgenden Jahrzehnt das früher rückständige Berlin zum Ort der künstlerischen Avantgarde, München hingegen allmählich zur „Stadt der Bewegung“, Bayern zur „Ordnungszelle“. Zeitgenössische Kunst hat es dort nun zunehmend schwer; die Avantgarde wechselt nach Berlin, das in den zwanziger Jahren kulturell aufblüht. Goebbels wählt München zum Ort der Ausstellung „Entartete Kunst“ aus, die dort 1937 gezeigt wird.
Die zwanziger Jahre bedeuten für Kunst und Kultur in Deutschland insgesamt eine intensivierte Modernitätserfahrung. Trotz mancher – für heutige Betrachter gelegentlich überraschender – Liberalität und Dynamik in der Vorkriegsepoche war die soziale und politische Ordnung der Welt von Gestern doch insgesamt ein Hemmschuh gewesen. Dementsprechend wird nun, unter den gewandelten Vorzeichen, mit neuen Kunstformen experimentiert und durch diese werden auch neue Adressaten angesprochen. Masse, Angestelltenkultur und Asphaltliteratur sind die - überwiegend negativ konnotierten - Stichworte der Zeit.
Gleichzeitig ist für viele Menschen der verlorene Krieg und die bedrohlich empfundene Umbruchserfahrung Auslöser dafür, illiberale Restaurationsideen zu unterstützen und Schuldige außerhalb der Volksgemeinschaft zu suchen. Thomas Mann, der sich allmählich und widerstrebend vom Monarchisten zum Vernunftrepublikaner entwickelt hat, engagiert sich schließlich für Demokratie und Toleranz. Sein Bruder Heinrich streitet schon länger für Sozialismus und Pazifismus. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird die Situation der Brüder und ihrer Familien prekär; Heinrich verläßt das Land am 21. Februar 1933, sein Bruder wird von einer Vortragsreise, die er am 11. Februar 1933 antritt, nicht mehr zurückkehren. Die Brüder Mann sind hier nur zwei unter vielen Betroffenen.
Das Exil bringt den allermeisten deutschen Künstlern, Schriftstellern und Intellektuellen wirtschaftliche Unsicherheit, Heimatlosigkeit, Sprachverlust - aber es sichert immerhin ihr Überleben.
Literatur zum Thema:
Stefan Bollmann, Zeit der Verwandlung. München 1900 und die Neuerfindung des Lebens, 2023, Klett-Cotta, 380 Seiten
Victor Klemperer, Man möchte immer weinen und lachen in einem. Revolutionstagebuch 1919, Aufbau-Verlag (Lizenzausgabe Büchergilde Gutenberg) 2015, 263 Seiten
Elisabeth Tworek, Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann. Von der Boheme zum Exil. Bilder, Dokumente, Kommentare, Verlag Friedrich Pustet 2016, 256 Seiten
Volker Weidermann, Träumer. Als die Dichte die Macht übernahmen, 2017, Kiepenheuer und Witsch (Lizenzausgabe Büchergilde Gutenberg: 2018)
Wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen hat, dann zeigen Sie Ihre Unterstützung doch durch ein “Like” oder schicken ihn an jemanden, der auch interessiert sein könnte. Vielen Dank!
Warum abonnieren?
Abonnieren Sie, um vollen Zugang zum Newsletter und den Publikationsarchiven zu erhalten.
Derzeit ist der größte Teil des Angebots kostenfrei, weil es mein Hobby ist und ich ja auch noch gar keine große Leserschaft habe. Wer mag, kann allerdings bereits jetzt eine bezahlte Mitgliedschaft auswählen, aber in jedem Fall ist auch das kostenfreie Abonnement eine sehr wichtige ideelle Unterstützung, die ich zu schätzen weiß.
Mehr über die Notizhefte:
Gestartet 2013 als Buchblog, inzwischen auf vielen Plattformen unterwegs. Hier sollen nicht Buchrezensionen oder -empfehlungen im Mittelpunkt stehen, auch wenn es sie geben wird. Der Fokus liegt hier eher auf Essays, in denen sich Lebenserfahrung mit Neugier mischt und es auch mal um grundsätzliche Fragen geht.
Wortlaut einer Inschrift über dem Kirchenportal des Augustinerchorherrenstifts Polling aus dem 18. Jahrhundert. Im Sprachgebrauch wurde nach Kriegsende 1945 "Liberalitas Bavariae" vorherrschend. Näher siehe https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Liberalitas_Bavarica .
Ernst Toller (1893-1939) übernahm nach der Ermordung Kurt Eisners den Vorsitz der bayerischen USPD und wurde zu einem der Protagonisten der Räterepublik. Später wegen Hochverrats angeklagt, wurde er zu vergleichsweise milden fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Toller bewegte sich seit 1917 in literarischen Zirkeln und nutzte die Haftzeit für das eigene Schreiben. Der ehemalige Frontsoldat war überzeugter Pazifist und emigrierte 1932; er starb 1939 in New York.
Ob es gleichwohl angemessen ist, ihn wie Weidermann als “der junge Reporter Victor Klemperer” (Weidermann, S. 221) zu bezeichnen, mag bezweifelt werden.
Romain Rolland, Über den Gräben, Aus den Kriegstagebüchern 1914-1919, Auszüge hrsg. von Hans Peter Bühler, 2015, S. 150ff.






